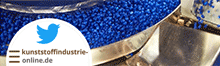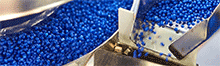„Shaping the circular economy“ lautet eines der drei Hot Topics der K 2025, die vom 8. bis 15. Oktober in Düsseldorf stattfindet. Denn nur mit einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft lässt sich die Rohstoffkrise bewältigen. Mehr als 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe werden zwar jährlich verbraucht. Doch mehr als 90 Prozent der verwendeten Rohstoffe werden nicht recycelt. Diese alarmierende Bilanz zieht die Europäische Investitionsbank. Der Druck auf Unternehmen, ressourcenschonender zu wirtschaften, wird durch steigende CO2-Kosten, volatile Rohstoffpreise und geopolitische Unsicherheiten noch verstärkt.
Deshalb gilt die Kreislaufwirtschaft als entscheidender Hebel für eine nachhaltige Zukunft. Eine Analyse der Unternehmensberatung Material Economics zeigt, dass Europa durch geschlossene Stoffkreisläufe bis 2030 jährlich 450 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen könnte. Dies entspricht acht Prozent der heutigen Emissionen. Langfristig, so prognostiziert die Ellen MacArthur Foundation, könnten weltweit bis zu 45 Prozent der Emissionen durch eine geschlossene zirkuläre Wirtschaft vermieden werden.
Nutzung von Sekundärrohstoffen spart bis zu 90 Prozent Energie
Wirtschaftlich birgt der Wandel enormes Potenzial: Nach Schätzungen der Unternehmensberatung EY senkt der Einsatz von Sekundärrohstoffen den Energieverbrauch um 20 bis 90 Prozent. Das spart große Mengen Wasser und könnte europäische Unternehmen jährlich um bis zu 465 Milliarden Euro Materialkosten entlasten. Außerdem rechnet die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) damit, dass durch die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft bis 2030 weltweit sieben bis acht Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Immer mehr Beispiele aus der Praxis zeigen, dass die Kreislaufwirtschaft nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist. Beispielsweise produziert die deutsche Cabka-Gruppe nach eigenen Angaben jährlich Paletten und Boxen aus rund 150.000 Tonnen recyceltem Kunststoff. Sie zeigt damit, wie aus Abfall werthaltige Produkte werden können.
K 2025 zeigt Fortschritte hin zu einer Kreislaufwirtschaft
Auf der K 2025 zeigen Unternehmen aus den Branchenzweigen Werkstoff-Erzeugung, Maschinenbau und Verarbeitung die Fortschritte und zukünftige Lösungen der Kreislaufwirtschaft. Auch die zahlreichen Specials der K greifen das Thema auf, allen voran das VDMA Forum. Der VDMA wird in 2025 wieder ein umfangreiches Forum im Freigelände präsentieren, dieses Mal unter dem Titel „The Power of Plastics“. Die offizielle Sonderschau „Plastics Shape the Future“ in Halle 6 wird von Plastrics Europe Deutschland organisiert. Das Diskussionsforum steht am 09. Oktober unter dem Motto: “Circular Thursday: Transition - Resilience of the industry - which technologies will make the circular economy work?”
Kunststoffindustrie als Schlüsselbranche mit Nachholbedarf
Bei dieser Transformation spielt die Kunststoffindustrie eine zentrale Rolle. Laut Plastics Europe wurden im Jahr 2023 weltweit 413,8 Millionen Tonnen Kunststoffe produziert. Doch der Anteil an Recyclingmaterial ist nach wie vor gering: Nur 8,7 Prozent der Kunststoffe wurden meist werkstofflich recycelt. Der Großteil wurde verbrannt oder deponiert. Dabei haben Rezyklate ein enormes Potenzial. Für ihre Herstellung wird deutlich weniger Energie benötigt als für die Produktion von Neuware aus fossilen Rohstoffen. So wird der CO2-Ausstoß erheblich reduziert. Zusätzlich stärkt ihr Einsatz die Versorgungssicherheit. Dieser Faktor wird in Zeiten geopolitischer Krisen immer wichtiger.
Allerdings ist das Recycling technisch anspruchsvoll und oft teurer als die Herstellung neuer Kunststoffe. In der Tat müssen Altkunststoffe aufwendig sortiert, gereinigt und aufbereitet werden. Zudem sind die gesetzlichen Vorgaben streng, hochwertige Rezyklate knapp und viele Prozesse energieintensiv. Das führt insgesamt zu höheren Produktionskosten im Vergleich zu Neukunststoffen. „Aber niemand will die höheren Kosten bezahlen“, betont Ulrich Reifenhäuser, Vorsitzender des Ausstellerbeirats der K. „Kunststoff hat seinen Siegeszug angetreten, weil er so viel besser ist als andere Materialien. Aber der Schritt in die Kreislaufwirtschaft, der kostet Geld. Dieses Kostenproblem wird nicht ohne ordnungspolitische Vorgaben in den Griff zu bekommen sein.“
Die Frage, wie der Wandel zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft gelingen kann, wird international unterschiedlich beantwortet.
Europa setzt auf Regulierung
Europa regelt per Gesetz. Dazu zählen Strategien wie der „Circular Economy Action Plan“ (CEAP) und Richtlinien wie die Verpackungsverordnung (PPWR). Auch die Einwegkunststoffrichtlinie (SUPD) treibt mit Recyclingquoten, verpflichtenden Rezyklatanteilen und erweiterter Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility) den Umbau zur Kreislaufwirtschaft voran. Die PPWR zeigt, was das bedeutet: PET-Einwegflaschen müssen seit 2025 mindestens 25 Prozent Recycling-Kunststoff enthalten. Bis 2030 steigt die Quote auf 30 Prozent. Das bedeutet für Hersteller wie Coca-Cola oder Nestlé: Lieferketten umstellen, hochwertiges Rezyklat beschaffen, Produktion anpassen - sonst droht ein Verkaufsstopp. Die SUPD zeigt ebenfalls Wirkung: In nur zwei Jahren stieg in Litauen die Rücklaufquote von PET-Flaschen nach Einführung eines Pfandsystems von 34 auf 92 Prozent. Die Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Denn die Verfügbarkeit hochwertiger Rezyklate ist begrenzt und die Umstellung auf recyclinggerechtes Design technisch aufwendig. Auch ist die Zeit für die Umsetzung der oft komplexen Vorgaben knapp bemessen.
Zunehmend rücken auch chemische Inhaltsstoffe in den Fokus der Europäischen Union. Insbesondere der Umgang mit PFAS ist umstritten, da ein Verbot das Recycling erheblich erschweren könnte. Viele Kunststoffabfälle würden dann als kontaminiert gelten und aus dem Kreislauf fallen. Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des VCI, warnt deshalb vor einem Pauschalverbot: „Mit jedem einzelnen dieser dann in der EU verbotenen Stoffe wächst die Gefahr für weitere Abwanderung unserer Industrie in weniger streng regulierte Regionen. Das Ursprungsproblem löst es allerdings nicht.“
Asien mäandriert zwischen Fortschritten und strukturellen Defiziten
Mit einem Anteil von 53 Prozent an der weltweiten Kunststoffproduktion ist Asien der wichtigste Akteur und die größte Quelle für Kunststoffabfälle. Einige Länder verfolgen ehrgeizige Recyclingstrategien, anderen fehlt es an der nötigen Infrastruktur.
Chinas steuert Kreislauf-Offensive zentral und setzt sie konsequent um
Lange Zeit war China der größte Importeur von Kunststoffabfällen. Nun steuert das Land um. China hat mit der „National Sword Policy“ den Import unsortierter Kunststoffabfälle gestoppt. Das Land forciert nun den Aufbau eigener Recyclingstrukturen. Hier setzt der 14. Fünfjahresplan auf moderne Sammel- und Trennsysteme und fördert das werkstoffliche und chemische Recycling. Die Industrie soll bis 2035 weitgehend dekarbonisiert und auf geschlossene Stoffkreisläufe umgestellt werden. Begleitet wird die Strategie vom „Circular Economy Promotion Law“. Unternehmen werden zur Rücknahme und schadlosen Entsorgung bestimmter Produkte verpflichtet. Die Gründung des Staatskonzerns „China Resources Recycling Group soll die Transformation zentral steuern.
Japan und Südkorea agieren als Technologietreiber mit System
Zu den Pionieren der Kreislaufwirtschaft zählen Japan und Südkorea, nicht zuletzt aufgrund klarer politischer Zielvorgaben und frühzeitiger Gesetzgebung. In Japan verpflichtet der „Container and Packaging Recycling Act“ Unternehmen bereits seit den 1990er Jahren zur Teilnahme an Rücknahme- und Recyclingsystemen. Dies wird durch den „Plastic Resource Circulation Act“ von 2022 ergänzt, der den Einsatz von Rezyklaten fördert und detaillierte Recyclingpläne für Kunststoffprodukte vorschreibt.
Südkorea verfolgt mit dem neuen „Act for Promotion of Transition to a Circular Economy Society“ einen systemischen, technologiegetriebenen Ansatz. Dieser beinhaltet verbindliche Recyclingquoten, klare Vorgaben für nachhaltiges Produktdesign sowie gezielte Regulierung für schwer recycelbare Produkte. Zudem werden Unternehmen, die beispielsweise neue Recyclingtechnologien auf den Markt bringen wollen, befristet von Auflagen befreit.
Im Gegensatz zu Europa setzen beide Länder weniger auf kleinteilige Regulierung, sondern auf klare Zuständigkeiten, praxisnahe Umsetzung und gezielte Innovationsförderung. Dieser Ansatz wird ergänzt durch eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz und breite Mitverantwortung, etwa bei der Abfalltrennung und Ressourcenschonung.
Kreislaufwirtschaft stockt von Indien bis Indonesien
Das indische Gesetz „Plastic Waste Management Rules“ verpflichtet Unternehmen zur Rücknahme von Kunststoffabfällen. Trotz dieses wichtigen Schrittes bleiben die unzureichende Infrastruktur und die regional unterschiedliche Umsetzung eine große Herausforderung für die flächendeckende Umsetzung. Vor ähnlichen Problemen steht Vietnam, wo im Jahr 2022 ein Gesetz zur Rücknahme von Kunststoffabfällen eingeführt wurde. Dieses verpflichtet Hersteller und Importeure, für die Recyclingfähigkeit ihrer Produkte zu sorgen.
Thailand verfolgt mit der „Plastic Waste Management Roadmap 2030“ das Ziel, bis 2027 sämtliche Kunststoffabfälle zu recyceln oder energetisch zu verwerten. Auch in Indonesien gibt es lokale Initiativen, aber keine umfassende nationale Strategie. Zu den Zielen gehört es, den Plastikmüll, der ins Meer gelangt, bis 2040 drastisch zu reduzieren.
Ungeachtet der Fortschritte in diesen Ländern stellen die regionale Fragmentierung der Abfallbewirtschaftung und die fehlende Infrastruktur nach wie vor eine große Herausforderung dar. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und eine stärkere Beteiligung der Industrie sind für den Erfolg dieser Maßnahmen von entscheidender Bedeutung.
Keine einheitlichen Strategien in Nordamerika
Nordamerika ist in Sachen Kreislaufwirtschaft stark fragmentiert. In den USA wird ein Ansatz verfolgt, der sowohl von staatlichen Initiativen als auch von privatwirtschaftlichen Maßnahmen geprägt ist. So haben 33 Bundesstaaten EPR-Programme aufgelegt, die Hersteller von Einwegverpackungen verpflichten, sich finanziell an der Entsorgung zu beteiligen. Bis 2032 sollen 100 Prozent der Verpackungen recycelbar oder kompostierbar sein. 65 Prozent der Einwegverpackungen sollen recycelt werden. Andere Bundesstaaten hinken jedoch hinterher. Dort gibt es weder ein landesweites noch ein zumindest flächendeckendes Recyclingprogramm. Vielmehr entscheiden die einzelnen Städte und Gemeinden selbst, ob, wie und welche Abfälle sie sammeln und sortieren.
Einen umfassenderen Ansatz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft verfolgt Kanada. Mit dem „Federal Plastics Registry“ hat die Regierung ein nationales Kunststoffregister eingeführt, um Daten zur Herstellung, Verwendung und Entsorgung von Kunststoffen zu sammeln. Dies soll die Transparenz erhöhen und ein effektiveres Kunststoffmanagement ermöglichen. Der „Aktionsplan Zero Plastic Waste“ zielt darauf ab, die Plastikverschmutzung zu reduzieren und eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu etablieren. Dazu gehören Maßnahmen zur Reduzierung von Einwegkunststoffen und zur Förderung von Mehrweg und Recycling. Außerdem wird ein schrittweiser Ansatz verfolgt, der durch das Verbot von Einwegkunststoffprodukten und die Einführung von EPR zur Reduzierung von Kunststoffabfällen beitragen soll.
Der lange Weg Südamerikas
In Südamerika steckt die Kreislaufwirtschaft noch in den Kinderschuhen. Etwa 90 Prozent der Abfälle landen auf Deponien. Recycling spielt bislang nur eine untergeordnete Rolle. In Chile, Kolumbien und Brasilien gibt es nationale Programme zur Rücknahme und Kreislaufwirtschaft, wie das chilenische „Ley REP“, Kolumbiens Initiative „Basura Cero“ oder freiwillige Branchenlösungen in Brasilien. Uruguay setzt mit dem Gesetz zur integrierten Abfallwirtschaft auf ein einheitliches Abfallmanagement und fördert das Recycling von Verpackungen. Trotz verschiedener Fortschritte und Initiativen bleibt die Infrastruktur in vielen Regionen Südamerikas unzureichend. Der Erfolg wird von weiteren staatlichen Investitionen, internationaler Zusammenarbeit und einer stärkeren Sensibilisierung der Bevölkerung abhängen.
Fazit und Ausblick für eine globale Kreislaufwirtschaft
Für die Kunststoffindustrie ist die Kreislaufwirtschaft Verpflichtung und Chance zugleich. Europa setzt stark auf Regulierung, Asien kombiniert staatliche Steuerung mit Technologieoffensiven. In Nord- und Südamerika reicht das Spektrum von ambitionierten Vorgaben über einen Flickenteppich von Einzelmaßnahmen bis hin zum Vertrauen auf die unsichtbare Hand des Marktes.
Allerdings hat jedes Kreislaufwirtschaftsmodell seine Tücken: Regulierung schafft zwar klare Regeln, kann aber auch zu Überbürokratisierung und ausbleibenden Investitionen führen. Marktbasierte Ansätze fördern Innovationen. Sie garantieren aber keine flächendeckende Umsetzung. Durch zentral gesteuerte Strategien werden schnelle Fortschritte erzielt, aber es besteht die Gefahr der Ineffizienz. Fest steht: Ohne höhere Recyclingquoten und mehr Rezyklate bleibt die Kreislaufwirtschaft Stückwerk. Durch gegenseitiges Lernen können Stärken kombiniert und Schwächen ausgeglichen werden.